Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Interview mit Jacques Witkowski, Präfekt der Region Grand Est, und Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien
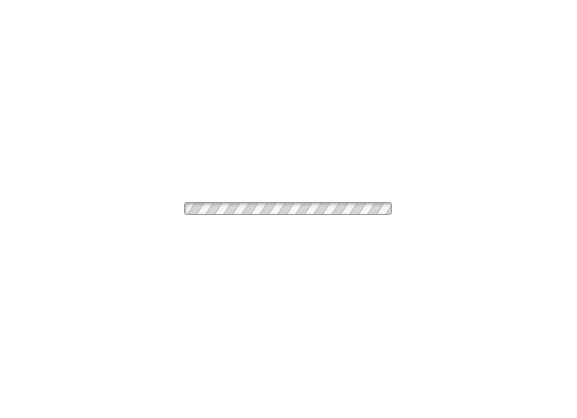
Welche Prioritäten hat sich Rheinland-Pfalz für die kommende AGZ-Sitzung gesetzt? Was erwarten Sie von diesem Treffen des Ausschusses in Ihrem Bundesland?
Heike Raab: Rheinland-Pfalz will im deutsch-französischen Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit gemeinsam mit den Partnern klare und zugleich zukunftsweisende Prioritäten setzen. Wir sind sowohl in dem Kooperationsraum der Großregion als auch dem des Oberrheins tätig. Damit übernehmen wir Verantwortung für Europa und wichtige europäische Themen in enger Abstimmung mit unseren französischen Nachbarn... Wir wollen die Zukunft Europas, und Transformation der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in Deutschland und Europa vorantreiben. Priorität hat für uns außerdem die Stärkung der grenzüberschreitenden Katastrophenhilfe. Ob bei Extremwetter oder bei Ereignissen wie Waldbrände oder Hochwasser – nur durch einen gemeinsamen europäischen Ansatz und eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen den Behörden können wir uns bestmöglich auf Krisensituationen vorbereiten und effektiv handeln. Unser Ziel ist es, praxisnahe Lösungen für reibungslose und schnelle Einsätze im deutsch-französischen Grenzraum zu finden. Dazu gehört unter anderem die Harmonisierung von Vorschriften oder der Aufbau einer grenzüberschreitenden Kommunikationsstruktur, um im Ernstfall Zeit zu sparen und Menschenleben zu schützen. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf den Ausbau erneuerbarer Energien, so auch der Geothermie. Wir sehen hier enormes Potenzial, um die europäische Energiewende und den wirtschaftlichen Wandel nachhaltig zu gestalten. Gerade im Oberrheingraben besteht die Chance, geothermische Ressourcen zu erschließen und damit einen wichtigen Beitrag zur regionalen und europäischen Energieversorgung zu leisten. Dabei ist es uns wichtig, frühzeitig und transparent über mögliche Risiken zu informieren, rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken. Nur so können wir das volle Potenzial der Geothermie nutzen und gleichzeitig den europäischen Gedanken der Zusammenarbeit weiter festigen. Von dem Treffen des AGZ erwarten wir uns daher konkrete Impulse für innovative Projekte, die sowohl die deutsch-französische Freundschaft als auch die europäische Integration vertiefen. Indem wir bestehende Synergien noch intensiver nutzen und unsere Erfahrungen bündeln, können wir einen wichtigen Beitrag zur Krisenvorsorge und zur energetischen Zukunft Europas leisten.
Rheinland-Pfalz grenzt an drei Staaten: Frankreich, Luxemburg und Belgien. Sehen Sie Besonderheiten in den Beziehungen zu diesen Partnern?
Heike Raab: Rheinland-Pfalz grenzt an drei europäische Kernländer – Frankreich, Luxemburg und Belgien. Hier wird der Geist des europäischen Miteinanders täglich neugestaltet wird und neugestaltet werden muss. Als Land im Zentrum der Gründungsmitglieder der EU, in einem Jahr, in dem wir 75 Jahre seit der Schuman-Erklärung feiern, zeigt sich einmal mehr, dass die europäische Integration gerade in den Regionen fest verankert ist. Unser Grenzraum, in dem verschiedene Kulturen, Wirtschaftsstrukturen und Traditionen aufeinandertreffen, ist der Ort, an dem Europa aktiv gelebt und gestaltet wird. Rheinland-Pfalz versteht sich als zentraler Dreh- und Angelpunkt, der eine Brücke zwischen den Nachbarstaaten und der europäischen Gemeinschaft bildet. Die langjährigen und tief verwurzelten Beziehungen zu Frankreich gehen weit über politische Kooperationen hinaus und spiegeln den kontinuierlichen Dialog und die gemeinsame Verantwortung wider, die den europäischen Zusammenhalt prägen. Gleichzeitig stärken enge und vertrauensvolle Partnerschaften mit Luxemburg und Belgien unser Engagement für eine solidarische und zukunftsorientierte Zusammenarbeit. Gerade in Zeiten globaler Herausforderungen zeigt sich, wie wichtig verlässliche Partner sind – Partner, mit denen wir eine bewährte europäische Freundschaft teilen, die auf Vertrauen, Respekt und dem gemeinsamen Streben nach Frieden und Fortschritt beruht.
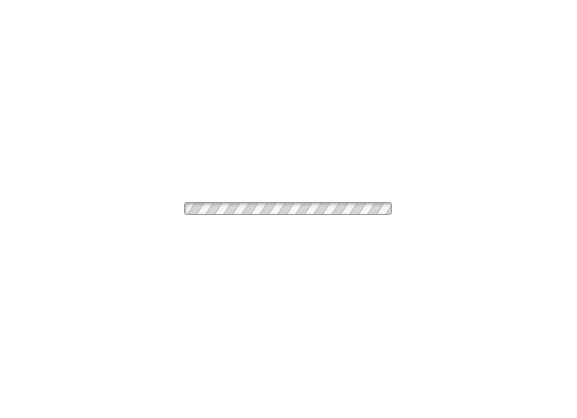
Sie haben Ihre Stelle als Regionalpräfekt im vergangenen Herbst angetreten. Ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für Sie eine Priorität in Ihrer Arbeit?
Jacques Witkowski: Als ich meinen Posten als Regionalpräfekt im Grand Est antrat, war mir klar, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine wesentliche Achse meiner Arbeit sein würde. Seitdem konnte ich ihre Lebendigkeit feststellen, genau wie bereits vor 20 Jahren als Unterpräfekt von Sélestat. Die Region hat eine fast 800 km lange gemeinsame Grenze mit Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Belgien: die Kooperation mit diesen Ländern ist daher natürlicherweise eine Priorität für die Regionalbehörden des französischen Staats und stellt einen wesentlichen Bestandteil meiner Aufgaben dar. In diesem Rahmen ist die Zusammenarbeit mit Deutschland ein Schwerpunkt, der mit der historischen, geografischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedeutung unserer Verbindungen zusammenhängt. Sie erstreckt sich auf alle Politikbereiche, von denen ich hier einige erwähnen möchte:
Öffentliche Ordnung und Zivilschutz: Ob im Rahmen des Gemeinsamen Zentrums für deutsch-französische Polizei- und Zollzusammenarbeit, der deutsch-französischen Einsatzeinheit, der deutsch-französischen Wasserschutzbrigade oder im Austausch zwischen den Dienststellen für Katastrophenschutz und Feuerwehr – die Kooperation ist konkret und alltäglich. Durch ihre Zusammenarbeit tragen französische und deutsche Einsatzkräfte dazu bei, die Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger über die Grenze hinweg zu gewährleisten. Es handelt sich um einen zentralen Schwerpunkt, der in Anbetracht des 40-jährigen Jubiläums des Schengen-Raums noch weiter vertieft werden sollte.
Gesundheit: Die Erfahrungen der Pandemie haben uns eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig dieser Teil der Zusammenarbeit ist. Es gibt bereits grenzüberschreitende Abkommen über medizinische Nothilfe oder die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, aber ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Bereich noch weiter gehen. Gemeinsam müssen wir ehrgeiziger sein, indem wir gemeinsame Überlegungen über die gegenseitigen Bedarfe und die Art und Weise, wie sie gedeckt werden können, anstellen.
Mobilität: Am Schnittpunkt der großen europäischen Korridore müssen wir in unserer Region daran arbeiten, die Mobilität unserer Mitbürger weiter zu erleichtern, sei es auf lokaler Ebene für die kurzen Wege des Alltags oder auf globalerer Ebene, indem wir uns in die großen Verkehrsachsen einfügen. Hierfür zählen wir auch auf die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union, um Projekte umzusetzen, die die Vernetzung und Multimodalität im Sinne einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung fördern.
Die Grenzregion wird oftmals als „deutsch-französisches Labor für die europäische Integration“ bezeichnet. Haben Sie den Eindruck, dass in der Bevölkerung ein „europäisches Bürgerbewusstsein“ existiert?
Jacques Witkowski: Es stimmt, dass die öffentlichen Behörden hier vielleicht mehr als anderswo dem europäischen Integrationsprozess in besonderem Maße verbunden sind. Dies ist natürlich das Ergebnis der Geschichte, aber auch des Engagements von Politikerinnen und Politikern, die das Erbe der Gründerväter Europas pflegen. Vor allem in Straßburg, der Hauptstadt des demokratischen Europas und der Menschenrechte, setzen wir uns gemeinsam für das europäische Projekt ein, das als einziges Frieden, Wohlstand und Stabilität garantieren kann. Über den Dreijahresvertrag „Europäische Hauptstadt Straßburg“ investieren der Staat und die Gebietskörperschaften, um die von Straßburg wahrgenommene Rolle als europäische Hauptstadt zu festigen und auszubauen. Zahlreiche von Bürgern getragene Projekte werden in diesem Rahmen begleitet und ermöglichen es, die Werte, die uns vereinen, zum Vorschein zu bringen. Allerdings ist anzumerken, dass die Region Grand Est nicht die Region ist, in der die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen am höchsten ist (52 % gegenüber 57 % z. B. in der Bretagne). Die Verbundenheit mit Europa sollte daher nicht als Selbstläufer gesehen, sondern im Gegenteil im Alltag gegenüber den Mitbürgern mit Verweis auf die Errungenschaften und Erfolge Europas innerhalb unserer Grenzregion gepflegt werden.
Im grenzüberschreitenden Gebiet sind die Austauschbeziehungen sehr intensiv, sowohl im Hinblick auf die Mobilität der Arbeitskräfte als auch bei der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen zwischen Unternehmen. Wie kann Ihrer Meinung nach der AGZ dazu beitragen, die dabei auftretenden Schwierigkeiten zu lösen?
Heike Raab: Der AGZ ist ein entscheidendes und einzigartiges Instrument zur Koordinierung der staatlichen und regionalen Verwaltungen im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dank des Vertrags von Aachen – der mit Hilfe des AGZ umgesetzt werden soll – können wir die Gebietskörperschaften und grenzüberschreitenden Einrichtungen mit angemessenen Kompetenzen, Ressourcen und Verfahren ausstatten, sowohl auf lokaler als auch auf transeuropäischer Ebene. Der Ausschuss ermöglicht die kollektive Umsetzung gemeinsamer grenzüberschreitender Projekte und bietet somit einen Rahmen und Hebel, um Hindernisse für die Zusammenarbeit abzubauen. In einem Raum, in dem die Großregion und der Oberrhein zu den dynamischsten Regionen Europas und der Welt gehören, ist es zwingend notwendig, dieses reiche Beziehungsgeflecht zu vertiefen. Durch die Verbindung der wirtschaftlichen, institutionellen und politischen Akteure beiderseits der Grenze trägt der AGZ dazu bei, den Austausch zu strukturieren und zu dynamisieren, sei es im Bereich der Mobilität von Arbeitskräften oder der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Alles in allem ist dieser integrierte Ansatz von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und die Festigung der europäischen Verbundenheit in einem globalen Kontext gemeinsamer Herausforderungen.
Jacques Witkowski: Der AGZ muss einen Rahmen für den Dialog der zuständigen deutsch-französischen Akteure bilden und konkrete und pragmatische Lösungen vorschlagen, bei Bedarf auch über Ausnahmeregelungen. Der Ausschuss warnt die zuständigen Ministerien in den Hauptstädten vor Schwierigkeiten und trägt zur Suche nach Lösungen bei, wie zum Beispiel bei der Besteuerung von Grenzgängern. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hier ist schon lange etabliert, aber es ist das erste Mal, dass wir eine Instanz haben, die alle Akteure an der deutsch-französischen Grenze von Nord nach Süd, von der lokalen bis zur nationalen Ebene, vereint, und die Exekutive und Legislative zusammenbringt. Es bleibt eine junge Institution, die zum Zeitpunkt ihrer Einrichtung viele Hoffnungen geweckt hat, sich aber noch behaupten muss. Ich appelliere an alle AGZ-Mitglieder, diese Herausforderung im Rahmen ihrer Möglichkeiten anzugehen, und an das AGZ-Sekretariat, mit seinem Fachwissen und seiner Unterstützung zu dieser Aufgabe beizutragen. Hierfür benötigen wir auch die den Rückhalt der Hauptstädte. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, um die Verwaltungen an die Experimentierfreudigkeit zu gewöhnen, die im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit notwendig ist.
Der deutsch-französische Grenzraum ist durch viele Gemeinsamkeiten in Geschichte und Kultur geprägt. Inwiefern könnten die Bildungseinrichtungen, die Medien und die Gebietskörperschaften dies noch besser an die neuen Generationen weitergeben?
Heike Raab: Der deutsch-französische Grenzraum ist reich an gemeinsamen historischen und kulturellen Wurzeln. Aus einst erbitterten Feindschaften haben sich unsere Länder zu einem Motor der europäischen Integration entwickelt. Dieser Wandel durch Annäherung geht über Meilensteine wie die Schuman-Erklärung hinaus und wurde durch wegweisende Vereinbarungen wie den Elysee-Vertrag und den Aachener Vertrag weiter bekräftigt. Stolz und dankbar blicken wir in Rheinland-Pfalz auch auf ein besonderes Jubiläum: Das 40-jährige Jubiläum des Abkommens von Schengen. Die Öffnung der Grenzen und die Freizügigkeit sind eine der größten Errungenschaften Europas. Was ist noch wichtig? Bildungseinrichtungen spielen für unsere Zukunft eine entscheidende Rolle. Durch grenzüberschreitende Bildungsprogramme, gemeinsame Projekte und Austauschinitiativen können Schülerinnen und Schüler hautnah erleben, wie sich historische Feindschaften in den vergangenen Jahrzehnten in eine Basis für Kooperation und gegenseitiges Verständnis verwandelt haben. Dabei werden nicht nur historische Fakten vermittelt, sondern auch die zentralen Etappen, die diesen Prozess geprägt haben. Auch die Medien tragen wesentlich dazu bei, diesen Transformationsprozess lebendig zu machen. Durch innovative Formate, Dokumentationen und Berichte können sie das Erbe der Versöhnung und die Bedeutung dieser Meilensteine transparent und ansprechend darstellen. So wird das Bewusstsein für den Wert des gemeinsamen europäischen Projekts geschärft und die jüngeren Generationen werden motiviert, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen. Schließlich unterstützen die Gebietskörperschaften durch gezielte kulturelle Initiativen, Förderprogramme und gemeinsame Veranstaltungen die Bewahrung und Weiterentwicklung des vielfältigen Erbes im deutsch-französischen Grenzraum. Indem sie Geschichte, Kultur und diese wegweisenden Verträge in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, schaffen sie ein dauerhaftes Fundament für eine lebendige, zukunftsorientierte europäische Identität. Auf diese Weise kann aus der bewegten Vergangenheit – vom ehemaligen „Erbfeind“ hin zu einem kraftvollen Motor der europäischen Integration – nicht nur Lehre für die Zukunft gezogen werden; auch die Meilensteine dieses Weges dienen als inspirierende Beispiele für kommende Generationen.
Jacques Witkowski: Es wurde bereits viel erreicht aber ich bin überzeugt, dass noch mehr getan werden muss: Dazu gehört sicherlich das Erlernen der Sprache des Nachbarn, aber auch das Interesse an der lokalen Kultur und Geschichte und die Neugier auf den Anderen, der so nah ist. Dazu müssen Werkzeuge, Bezüge und Kommunikationsmittel genutzt werden, die die junge Generation ansprechen, die später das Ruder übernehmen wird, um den europäischen Geist am Leben zu erhalten. Außerdem müssen der Tourismus und der Jugendaustausch im Bereich des Umweltschutzes, der Pflege des Kulturerbes oder der wechselseitigen Teilnahme an Großveranstaltungen ausgebaut werden. In dieser Hinsicht war es uns eine Freude, dem olympischen Fackellauf nach Paris eine grenzüberschreitende Dimension zu verleihen.
